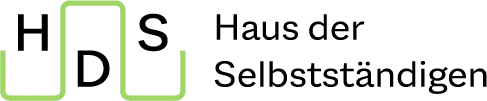-
HDS-Jahrestagung: Digitalisierung, Gender und Gerechtigkeit – Wie Solo-Selbstständige solidarische Perspektiven entwickeln
Weiterlesen: HDS-Jahrestagung: Digitalisierung, Gender und Gerechtigkeit – Wie Solo-Selbstständige solidarische Perspektiven entwickelnSeid dabei bei der HDS-Jahrestagung 2025 am 30. Oktober in Köln! Der digitale Wandel verändert die Arbeitswelt rasant – auch für Solo-Selbstständige. Online-Angebote, Social Media, Plattformen und Konkurrenz durch KI-Modelle […]
VERANSTALTUNGEN UND NEUIGKEITEN
Blog
-

Selbstständige und Corona: Wie die Krise nachwirkt
Weiterlesen: Selbstständige und Corona: Wie die Krise nachwirktWir laden herzlich ein zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem WSI am 17.11.2025 von 11:00 bis 16:00 Uhr im ver.di-Landesbezirk NRW in Düsseldorf. Gemeinsam mit Euch wollen wir die Arbeits- […]
-

Follow-up „Sorge(n) solidarisch gestalten“: Gute Interessenvertretung braucht verlässliche Daten
Weiterlesen: Follow-up „Sorge(n) solidarisch gestalten“: Gute Interessenvertretung braucht verlässliche DatenGroß war das Interesse an unserer Follow-up-Veranstaltung zum Thema Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Solo-Selbstständigkeit am 5. August. Wir freuen uns, dass wir offenbar viele solo-selbstständig Tätige mit dem Care-Thema ansprechen. […]
-

Sorge(n) solidarisch gestalten! Was brauchen Selbstständige mit Care-Verantwortung?
Weiterlesen: Sorge(n) solidarisch gestalten! Was brauchen Selbstständige mit Care-Verantwortung?Unter dem Titel „Sorge(n) solidarisch gestalten“ ging es am 18. Juni 2025 in einer gemeinsamen Veranstaltung des HDS Leipzig und des Spinnen-Netz ArbeitMitWirkung um die Frage „Was brauchen Selbstständige mit Sorgeverantwortung […]
-
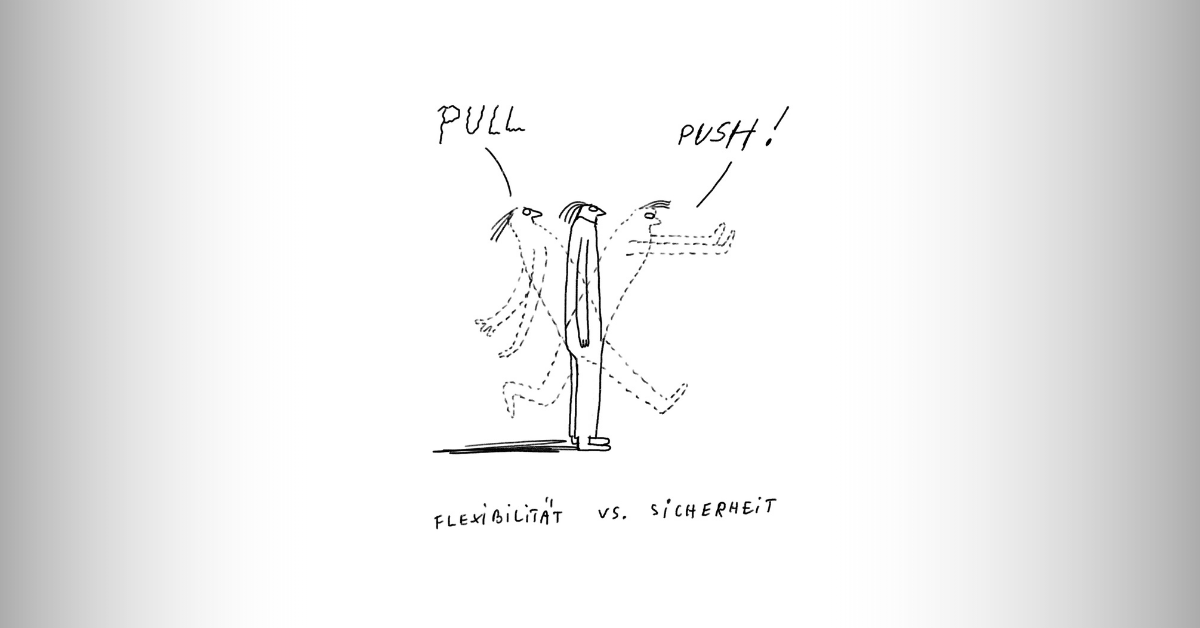
AustauschBar am 17. September: Nebenberufliche Selbstständigkeit – Auswirkungen auf die Kranken- und Rentenversicherung
Weiterlesen: AustauschBar am 17. September: Nebenberufliche Selbstständigkeit – Auswirkungen auf die Kranken- und RentenversicherungDie Grenzen zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit verschwimmen zunehmend: Immer mehr Menschen kombinieren beide Erwerbsformen oder wechseln flexibel zwischen ihnen. Im Idealfall kann in dieser Erwerbshybridität von der sozialen Absicherung […]
-

Sorge(n) solidarisch gestalten: Strukturelle Probleme erkennen, gemeinsame Lösungsansätze entwickeln
Weiterlesen: Sorge(n) solidarisch gestalten: Strukturelle Probleme erkennen, gemeinsame Lösungsansätze entwickelnAm 18. Juni hatten wir in Kooperation mit dem Spinnen-Netz ArbeitMitWirkung zum gemeinsamen Austausch über die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Solo-Selbstständigkeit eingeladen. Unsere zentrale Frage: Was brauchen Selbstständige mit Sorgeverantwortung […]
-

So war die Austauschbar im HDS Berlin zum Thema Auswirkungen des Herrenberg-Urteils auf die Bildungslandschaft
Weiterlesen: So war die Austauschbar im HDS Berlin zum Thema Auswirkungen des Herrenberg-Urteils auf die BildungslandschaftDas Bundessozialgericht stellte 2022 im sogenannten Herrenberg-Urteil fest, dass – mangels unternehmerischer Freiheit einerseits und der Eingliederung in den Betrieb andererseits – echte Selbstständigkeit an einer Musikschule kaum herzustellen sei. […]