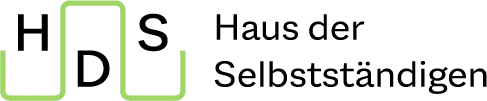-
HDS-Jahrestagung: Digitalisierung, Gender und Gerechtigkeit – Wie Solo-Selbstständige solidarische Perspektiven entwickeln
Weiterlesen: HDS-Jahrestagung: Digitalisierung, Gender und Gerechtigkeit – Wie Solo-Selbstständige solidarische Perspektiven entwickelnSeid dabei bei der HDS-Jahrestagung 2025 am 30. Oktober in Köln! Der digitale Wandel verändert die Arbeitswelt rasant – auch für Solo-Selbstständige. Online-Angebote, Social Media, Plattformen und Konkurrenz durch KI-Modelle […]
VERANSTALTUNGEN UND NEUIGKEITEN
Blog
-
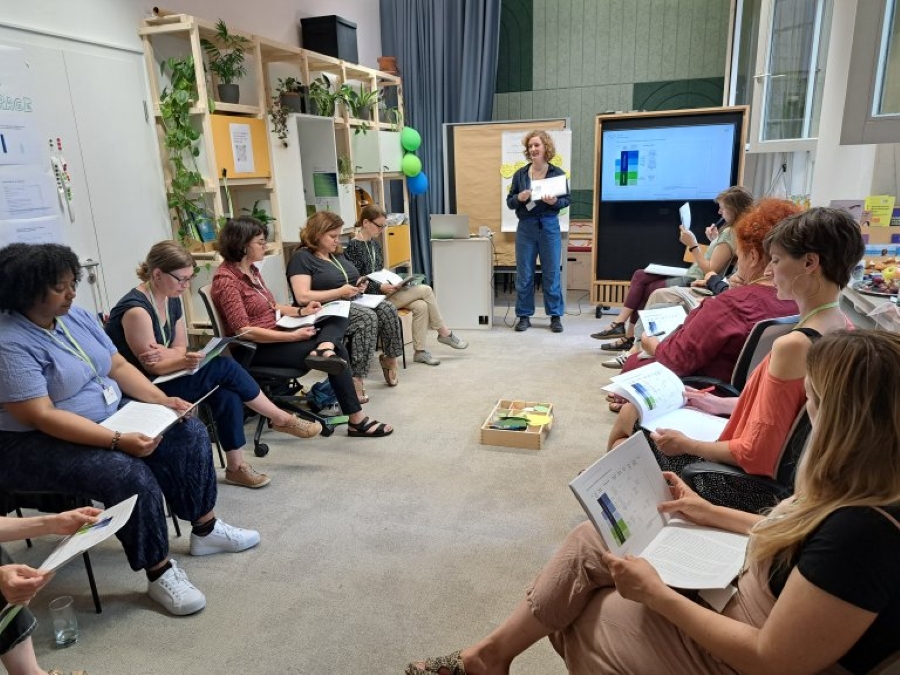
Selbstständig und Teilzeitjob – Die Vorteile der zwei Standbeine
Weiterlesen: Selbstständig und Teilzeitjob – Die Vorteile der zwei StandbeineBei der AustauschBar am 24. Juni 2025 haben Cosima Langer und Katrin Mauch von der Beratungsgesellschaft ArbeitGestalten ihre Studie zu Mehrfachtätigkeiten im CoSoliLab in Köln vorgestellt und mit Solo-Selbstständigen diskutiert. […]
-

Follow-up „Sorge(n) solidarisch gestalten“: Gute Interessenvertretung braucht verlässliche Daten
Weiterlesen: Follow-up „Sorge(n) solidarisch gestalten“: Gute Interessenvertretung braucht verlässliche DatenGroß war das Interesse an unserer Follow-up-Veranstaltung zum Thema Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Solo-Selbstständigkeit am 5. August. Wir freuen uns, dass wir offenbar viele solo-selbstständig Tätige mit dem Care-Thema ansprechen. […]
-

Vernetzung stärkt Solo-Selbstständige in Hamburg
Weiterlesen: Vernetzung stärkt Solo-Selbstständige in HamburgErstes Treffen bringt 20 Organisationen zusammen Am 14. Juli 2025 fand im Klub am Besenbinderhof das erste Vernetzungstreffen des Hauses der Selbstständigen Hamburg statt. 20 Organisationen, die sich für Solo-Selbstständige […]
-

Sorge(n) solidarisch gestalten! Was brauchen Selbstständige mit Care-Verantwortung?
Weiterlesen: Sorge(n) solidarisch gestalten! Was brauchen Selbstständige mit Care-Verantwortung?Unter dem Titel „Sorge(n) solidarisch gestalten“ ging es am 18. Juni 2025 in einer gemeinsamen Veranstaltung des HDS Leipzig und des Spinnen-Netz ArbeitMitWirkung um die Frage „Was brauchen Selbstständige mit Sorgeverantwortung […]
-

Sorge(n) solidarisch gestalten: Strukturelle Probleme erkennen, gemeinsame Lösungsansätze entwickeln
Weiterlesen: Sorge(n) solidarisch gestalten: Strukturelle Probleme erkennen, gemeinsame Lösungsansätze entwickelnAm 18. Juni hatten wir in Kooperation mit dem Spinnen-Netz ArbeitMitWirkung zum gemeinsamen Austausch über die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Solo-Selbstständigkeit eingeladen. Unsere zentrale Frage: Was brauchen Selbstständige mit Sorgeverantwortung […]
-

So war die Austauschbar im HDS Berlin zum Thema Auswirkungen des Herrenberg-Urteils auf die Bildungslandschaft
Weiterlesen: So war die Austauschbar im HDS Berlin zum Thema Auswirkungen des Herrenberg-Urteils auf die BildungslandschaftDas Bundessozialgericht stellte 2022 im sogenannten Herrenberg-Urteil fest, dass – mangels unternehmerischer Freiheit einerseits und der Eingliederung in den Betrieb andererseits – echte Selbstständigkeit an einer Musikschule kaum herzustellen sei. […]