Impostor-Workshop im HDS-NRW brachte Erkenntnisse und Motivation
Bin ich professionell genug? Kann ich alles, wofür ich mich bezahlen lasse? Lasse ich mich angemessen bezahlen oder reguliere ich mit einem niedrig angesetzten Honorar verinnerlichte Zweifel an meiner Kompetenz und trage dadurch zu meiner Ausbeutung bei? Diese Fragen sind typische Erscheinungsformen des so genannten „Impostor-Syndroms“, das umgangssprachlich auch als „Hochstaplersyndrom“ bezeichnet wird. Mit Unsicherheiten umzugehen und sich täglich neuen Herausforderungen zu stellen, gehört zum Tagesgeschäft Solo-Selbstständiger. Entsprechend groß ist der Anteil derjenigen, die unter Impostor-Symptomen leiden und nach Unterstützung suchen. So traf das Angebot des HDS NRW – ein Workshop im CoSoliLab Köln am 6. Februar – bei den Betroffenen ins Schwarze.
In dem ganztägigen Workshop gab es einen Austausch über verinnerlichte Zweifel, Unsicherheiten und mangelndes Selbstbewusstsein in der Selbstständigkeit sowie das Kennenlernen von Strategien des Umgangs mit diesen stressbehafteten Symptomen. Den Workshop leitete die erfahrene Psychotherapeutin und Supervisorin Dr. Anita Barkhausen. Das Angebot richtete sich an Frauen, Lesben, trans, inter und nicht-binäre Menschen, die haupt- oder nebenberuflich selbstständig tätig sind. Wie Präsent das Thema bei vielen Solo-Selbstständigen aus diesem Personenkreis ist, zeigte die übergroße Nachfrage zu dieser Veranstaltung, die einen solidarischen Raum des Miteinanders schuf. Mit 14 Teilnehmer*innen war der Workshop ausgebucht. Wahrnehmung und Würdigung der eigenen Professionalität auf der einen und wiederkehrende Selbstzweifel auf der anderen Seite waren die Stichworte, mit denen sich die Gruppe an diesem Tag beschäftigte.
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen erzeugen und verstärken das Syndrom
Im Gespräch erklärte Dr. Anita Barkhausen die verschiedenen Zusammenhänge, aus denen das Impostor-Syndrom entstehen kann. Von der Mehrheitsgesellschaft ausgehender Normierungsdruck trifft vor allem Personen, die Diskriminierung ausgesetzt sind oder es in ihrer Vergangenheit waren. Negative Fremdzuschreibungen durch andere werden im Laufe der Jahre als Selbstzweifel verinnerlicht. Der Angst, in den Augen der anderen nicht bestehen zu können, begegnen Betroffene schon im Vorfeld mit zahlreichen Mikro-Anstrengungen und der Bereitschaft, sich ihren Erfolg durch ein höheres Investment an Zeit zu „verdienen“. Mit Selbstoptimierungsstrategien begegnen sie der nach Innen genommenen Unsicherheit und fühlen sich dauernd auf Bewährung, so Barkhausen. Von intersektionalen Machtverhältnissen faktisch benachteiligte Personen fühlen sich in größeren Unternehmen und Organisationen oft nicht so sicher und arbeiten daher oft als Solo-Selbständige in ihrem vermeintlichen „safe space“.
Empowering durch gemeinsames Lernen
Im ganztägigen Workshop teilten die Teilnehmer*innen zunächst die verschiedenen Erscheinungsformen des Impostor-Syndroms in ihrer Solo-Selbstständigkeit wie z.B. Honorarangebote unter Marktwert abzugeben oder dem Erfolgsdruck durch Übervorbereitung und entgrenzte Arbeitszeiten zu begegnen; in Vermeidung von Selbstzweifeln zu prokrastinieren und gleichzeitig nicht zur Ruhe zu kommen.
In einem World-Café schauten die Teilnehmer*innen anschließend ihre Arbeitsweisen und äußeren Rahmenbedingungen an und diskutierten deren Auswirkungen. Wie arbeitet man ohne eigenes Büro? Ist das Arbeiten zuhause ein Safe-Space, der aber auch Vereinzelung verstärkt? Erlaube ich mir nur dann Urlaub zu machen, wenn ich gerade keine Aufträge habe?
Am Ende stand die Frage „Wie kann ich für mich selbst eine gute vorgesetzte Person werden?“ Die Teilnehmer*innen lernten viel darüber, wie sie sich selbst in ihrer Professionalität Wertschätzung, Motivation und Unterstützung entgegenbringen können. Dass es helfen kann, sich von Perfektionismus zu verabschieden, Erfolge zu feiern und Komplimente annehmen zu lernen.
Viele gute Beispiele wurden gesammelt, gegenseitiges voneinander Lernen sorgte für Empowering.
Am Ende des von gegenseitigem Respekt geprägten Tages sagte eine Teilnehmende: „Jetzt fühle ich mich weniger wie ein Freak“; eine andere meinte: „Jetzt kann ich mir erklären, woher meine Impostor-Tendenzen kommen, und sehe die politischen Dimensionen“. Nicht zuletzt die Erkenntnis, dass das Syndrom in vielerlei Hinsicht durch gesellschaftliche Fremdzuschreibungen getriggert wird, verstärkte den Wunsch nach weiterem Austausch und Vernetzung der Teilnehmer*innen.
Über einen Nachfolgetermin wird im HDS NRW nachgedacht. Ebenso, ob dieser Workshop auch als online-Variante unabhängig vom Wohnort der Interessent*innen angeboten werden kann. Wir bleiben dran!
Gundula Lasch
Infokasten Impostor-Syndrom
Das Impostor-Syndrom, auch Hochstaplersyndrom, ist weit verbreitet. Es wird als Phänomen, das trotz offensichtlicher Erfolge von Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten begleitet wird, beschrieben. Es wurde erstmals in den 1970ern von den Psychologinnen Pauline Rose Clance und Suzanne Imes beschrieben und betrifft laut einer Studie schätzungsweise 70 Prozent aller Menschen mindestens einmal im Leben. Häufige Merkmale des Hochstapler-Syndroms sind:
- Perfektionismus und Überkompensation
- Prokrastination und Selbstsabotage
- Fehlendes Selbstbewusstsein
- Fehlende Selbstakzeptanz und Abneigung gegenüber sich selbst
- Negative Glaubenssätze
- Distanz zum eigenen Team
- Unbewusste Selbstsabotage
- Unfähigkeit, Komplimente anzunehmen
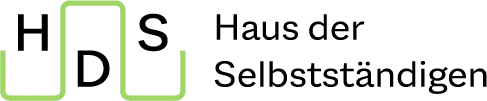

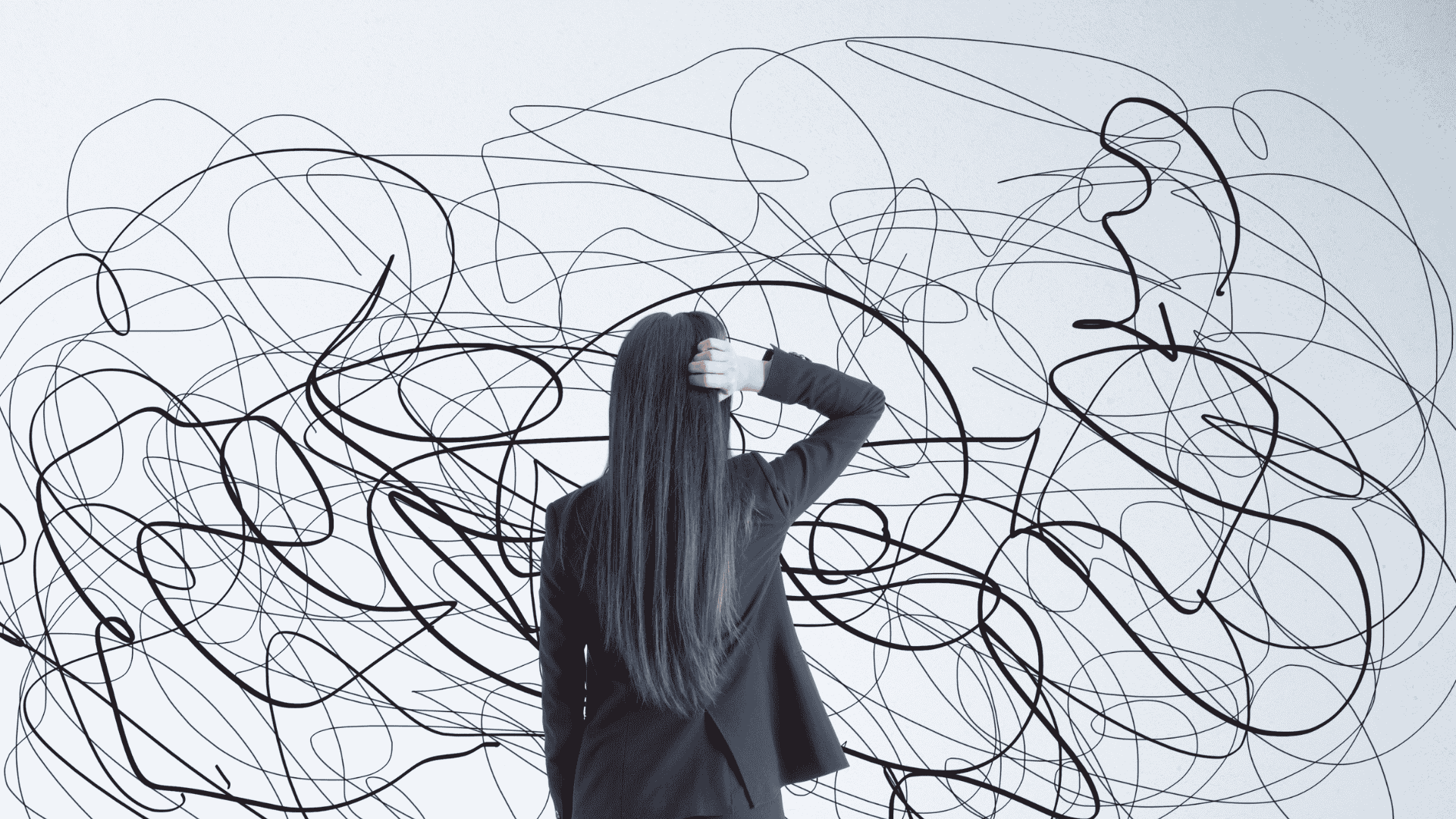


Schreibe einen Kommentar